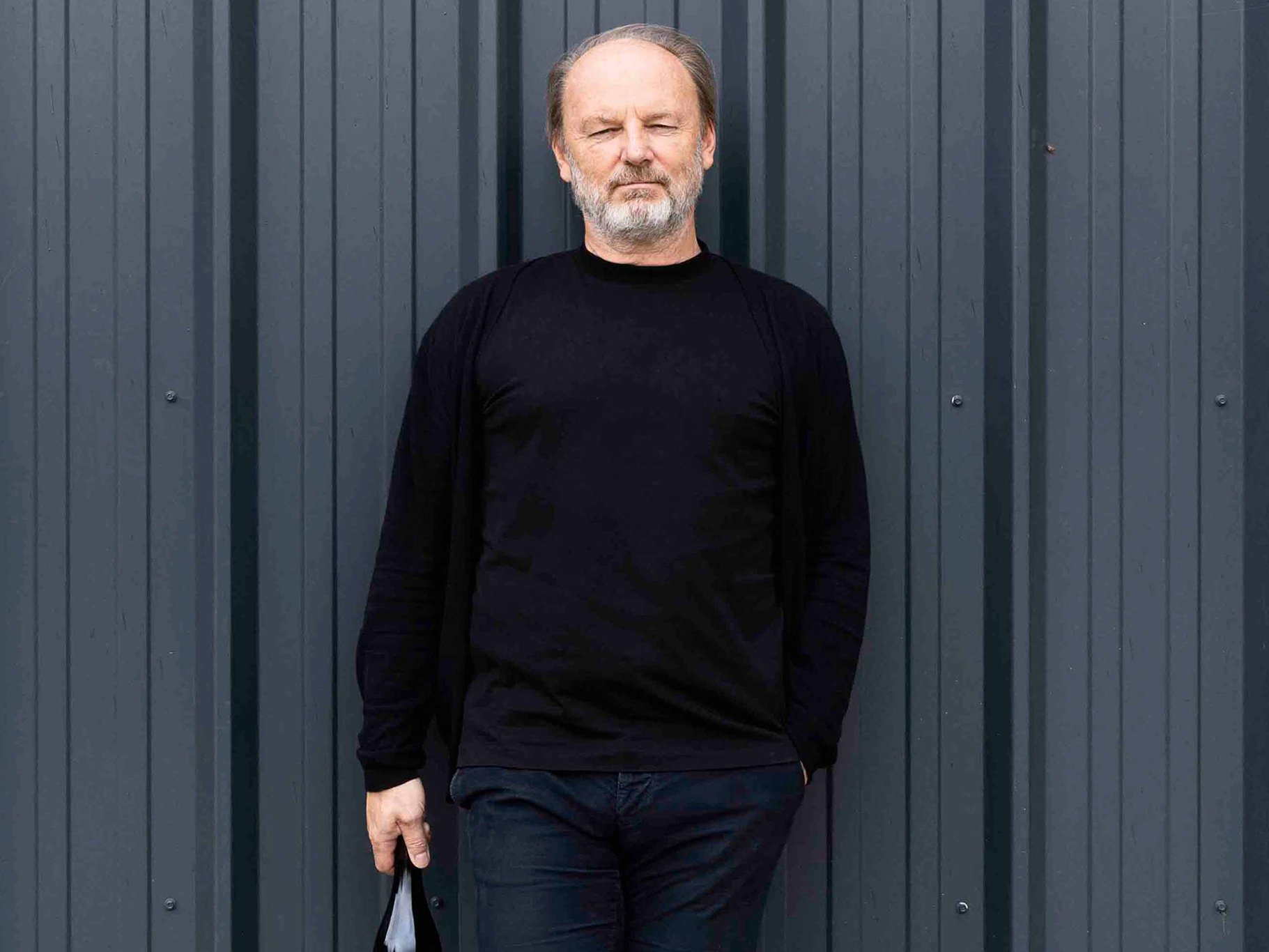Erfolgsgeschichte: 100 + 1 Jahre Burgenland
Die bewegte Geschichte des östlichsten Bundeslands reicht von einer langwierigen Identitätssuche bis zu einer Gegenwart, in der die pannonische DNA als Erfolgsmodell gefeiert wird. Mit viel Potenzial für die Zukunft.
So wie es sich heute im Südosten an die Republik schmiegt, ist das Burgenland ein historisches Zufallsprodukt. Nichts hatte noch während des Ersten Weltkriegs darauf hingedeutet, dass das damalige Deutsch-Westungarn schon bald an Österreich angeschlossen würde. Das ermöglichten erst der Zusammenbruch der Habsburgermonarchie und die darauf folgenden Wirren während der Aufteilung ihrer Bestandteile in neue Staaten. Vor hundert Jahren schließlich entstand das neue Bundesland.
Es ist eine Region, in der West und Ost aufeinandertreffen, in der eine gemischtsprachige Bevölkerung lebt, Deutsche, Kroaten, Ungarn, Roma und bis 1933 auch rund 3.000 jüdische Familien. Im Norden ist es von den Ausläufern der ungarischen Tiefebene geprägt, im Süden vom oststeirischen Hügelland. Archäologische Funde belegen eine dauerhafte Besiedelung seit der Jungsteinzeit vor rund 8.000 Jahren.
Bereits in der jüngeren Eisenzeit hatte die damalige keltische Bevölkerung im Gebiet des Bezirks Oberpullendorf ein blühendes Eisenhandelszentrum errichtet. Im Lauf der Jahrhunderte durchzogen unzählige Stämme die ehemalige römische Provinz Pannonien, Hunnen, Awaren, Goten, Gepiden oder Langobarden. Zu dieser Zeit fanden auch deutschsprachige Siedler aus dem bayerischen Raum ihren Weg in das flache, karge Land. Sie alle hinterließen ihre Spuren und prägen bis heute eine multiethnische Kultur.

Deutsch wurde verbannt
Um die erste Jahrtausendwende annektierten de Magyaren das Gebiet des heutigen Burgenlands und etablierten eine – durch wenige Interregnen unterbrochene – dauerhafte Herrschaft. In der Neuzeit dominierten zwei ungarische Magnatenfamilien, die Esterházys und Batthyánys, das Gebiet. Noch heute besitzen sie große Teile des Landes. Sie etablierten ein System der Leibeigenschaft (bis 1854) und der kleinen Pachtbauern. Nach dem Österreichisch-Ungarischen Ausgleich von 1867, mit dem die Donaumonarchie de facto in zwei Teile aufgeteilt wurde (das heutige Burgenland fiel an die Stephanskrone), betrieben die Behörden in Budapest eine konsequente Magyarisierungspolitik.
Deutsch wurde aus der Öffentlichkeit verbannt, Schulen, Behörden, Gerichte kannten nur die ungarische Amtssprache. Dennoch bildete sich bei allem Unmut keine Sezessionsbewegung, die deutschsprachige Bevölkerung empfand sich als Ungarn und fügte sich der Obrigkeit. Die Jahrhunderte der Leibeigenschaft hatten jeden Willen zum Aufbegehren erstickt. Die drei Komitate, die sich auf dem Gebiet des heutigen Burgenlands befanden, hinkten auch für ungarische Verhältnisse hinterher.
Mit der Ausnahme von Ödenburg (heute Sopron) entstanden nirgendwo urbane Zentren, industrielle Strukturen existierten nicht, das fast 4.000 Quadratkilometer große Gebiet wurde von einer kleinteiligen Landwirtschaft dominiert. Aufgrund der Realteilung – ein Besitz wird unter allen Söhnen aufgeteilt – bildete sich mit der Zeit ein ökonomisches Gefüge, das die einzelnen Familien nicht mehr ernähren konnte.
Das zwang die Bewohner zu großer Mobilität. Im Sommer verdingten sich viele Westungarn als Erntehelfer auf den großen aristokratischen Landgütern in Innerungarn. Während des Baubooms der Gründerzeit pendelten viele zu den Baustellen in Wien und Budapest. Manche Ortschaften stellten die Maurerkolonnen, andere die Zimmerleute. Dieses Bild der Wanderarbeiter blieb dem Burgenland bis heute erhalten. Viele burgenländische Biografien erzählen davon, wie die Bauarbeiter ihre Heimat verlassen mussten, weil sie in dem strukturschwachen Land kein Auskommen mehr finden konnten. In mehreren Wellen wanderten außerdem Zehntausende arme Schlucker vornehmlich in die Vereinigten Staaten aus, es war eine Massenmigration, die massiver ausfiel als in jedem anderen österreichischen Landesteil. Zeitweise hieß die größte burgenländische Stadt Chicago.

Das prägte Land und Leute. Viele seiner kulturellen Aspekte sind vom Mangel gezeichnet. Bis vor wenigen Jahrzehnten galt das Burgenland als das Armenhaus Österreichs, eine rückständige Grenzregion, durch den Eisernen Vorhang von seinem Hinterland abgeschnitten. In vielen Bereichen bildete das Burgenland das nationale Schlusslicht – die Einkommen hinkten hinterher, die Lebenserwartung war geringer, das Bruttoinlandsprodukt schwächelte. Und dennoch ist das Burgenland eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die sich niemand 1921 hätte träumen lassen.
Nach der Zerschlagung des Habsburgerreichs im Ersten Weltkrieg nahmen sich die Siegermächte vor, die nationalen Verhältnisse auf dem Gebiet des Vielvölkerstaats neu zu ordnen.
Ungarn beispielsweise verlor mehr als ein Drittel seines alten Territoriums an die Slowakei, Rumänien und eben auch an Österreich. Zunächst zeigten die Alliierten bei den Verhandlungen zu den Pariser Vorortverträgen, die eine neue Friedensordnung schufen, dem Wunsch der Wiener Regierung nach einem Anschluss Westungarns an die junge Republik die kalte Schulter. Für die meisten, die in dem Gebiet lebten, war das ein vollkommen neuer und auch verwegener Gedanke. Doch wohl auch unter dem Eindruck der kurzlebigen ungarischen Räterepublik änderten sie ihre Meinung, das Gebiet wurde Österreich zugesprochen.
Die Landnahme vor hundert Jahren erfolgte unter blutigen Wehen, bis zu 20.000 ungarische Freischärler stellten sich den österreichischen Einheiten entgegen, erst nach monatelangen Gefechten gelang es, den Widerstand zu brechen. Auf Geheiß der Alliierten Kommission wurde für Ödenburg, das natürliche Zentrum, eine Volksabstimmung angeordnet, bei der sich über 60 Prozent der Bevölkerung für den Verbleib in Ungarn aussprachen.

Die entscheidende Wende
Das neue österreichische Gebiet war ein Torso: Es hatte keinen Namen, keine Hauptstadt, keine Verwaltungsstrukturen, keine politische Organisation, es gab kein Theater, kein Museum, kein regionales Zentrum. Es war schlicht eine Agglomeration ländlicher Gemeinden und verschlafener Städtchen. So erscheint es fast als Wunder, dass bereits 1922 Landtagswahlen abgehalten werden konnten, welche die Sozialdemokraten gewannen. Zunächst spielte man in Wien noch mit dem Gedanken, die neuen Territorien zwischen Niederösterreich und der Steiermark aufzuteilen (wie das Jahre später das NS-Regime tat).
Doch schließlich setzte sich der Vorschlag durch, das ehemalige Westungarn als eigenständiges Bundesland in die Republik einzugliedern. Für viele Historiker war das die entscheidende Wende: Erst dadurch konnten eigene, regionalspezifische Strukturen errichtet werden, erst dadurch konnte sich ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. Dass man heute von einer burgenländischen Identität sprechen kann, von einem pannonisch geprägten Selbstbewusstsein, ist im Wesentlichen diesem Entschluss zu verdanken. Alles, was heute das moderne Burgenland ausmacht, vom platten Norden bis zum hügeligen Süden, wurde in diesen ersten hundert Jahren geschaffen.
Es war ein christlich-sozialer Dorfpolitiker aus Frauenkirchen, der vorschlug, das namenlose Gebiet Burgenland zu taufen. Mit dieser Namensgebung sollte ausgedrückt werden, dass sich das Land aus Gebieten der drei altungarischen Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg zusammensetzt. Die erste Landesregierung fand zunächst ihren provisorischen Unterschlupf in Bad Sauerbrunn, bevor sie einige Jahre später in die wenig bedeutende Kleinstadt Eisenstadt in den Schatten des Esterházy’schen Fürstenschlosses umzog.

Der grosse Durchbruch
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs litt das Bundesland vor allem darunter, dass der Eiserne Vorhang eine gedeihliche wirtschaftliche Entwicklung abwürgte. Das Grenzgebiet war Endstation, entlang der Stacheldrahtzäune patrouillierten bewaffnete Soldaten. Der großen Durchbruch gelang dem Burgenland erst, als die Grenzbefestigungen fielen. Es war nicht nur für das Burgenland, sondern für den gesamten Kontinent und die Welt ein historischer Augenblick. Am 27. Juni 1989 durchschnitten der österreichische und der ungarische Außenminister mit einem Bolzenschneider den Zaun. Das hatte unabsehbare Folgen: Tausende DDR-Bürger flohen durch diese erste kleine Lücke, der Strom war nicht mehr aufzuhalten, in kurzer Zeit war der Ostblock Geschichte.
In nur drei Jahrzehnten erblühte das Burgenland zu einem modernen, in vielen Aspekten vorbildlichen Gemeinwesen. Die touristische Infrastruktur, ein bedeutsamer wirtschaftlicher Faktor, ist größtenteils auf dem neuesten Stand. Der Neusiedler See, der Steppensee wurde gern als Meer der Wiener bezeichnet, galt früher als etwas trister Urlaubsort wenig wohlhabender Großstadtbewohner. Heute gilt er als schickes Ausflugsziel und dank des Nationalparks als ökologisches Kleinod. Das Land ist heute ein begehrtes Weinland und ein kleines kulinarisches Paradies. Arme-Leute-Küche von einst ist einem Feinkostladen gewichen.
Die Burgenländer verstehen es heute durchaus, von dem späten Aufschwung einen gewissen Stolz abzuleiten. Die Minderheitskomplexe, die früher viele begleitet hatten, sind verschwunden. Sie sind nach bloß hundert Jahren Eigenständigkeit ein heimatverbundener Menschenschlag geworden, der aus der besonderen Lage des Landes in Österreich und Europa Gewinn zu schlagen versteht. Das jüngste Bundesland der Republik ist zweifellos ein Erfolgsmodell, in dem es meist noch beschaulich zugeht. Lebensqualität ist hier ein primäres Ziel. Darüber hinaus hat im Burgenland die Zukunft bereits begonnen. Schon seit zwei Jahrzehnten stellt sich das Land der wahrscheinlich brennendsten Frage: der globalen Erwärmung und dem Hitzeschock, der droht.
Das ehrgeizige Ziel lautet: Klimaneutralität im Jahr 2030 – ein Jahrzehnt vor dem Rest der Republik. Bis dahin sollen die zwei Millionen Tonnen an CO2, die das Burgenland jährlich produziert auf null gesenkt werden. Energie soll dann nur mehr aus erneuerbaren Energieträgern gewonnen werden. Wenn sich, wie kürzlich, die Staatsmänner zu einer internationalen Klimakonferenz treffen, täten sie gut daran, einen Blick auf den Südosten Österreichs zu werfen. Dort ist vieles bereits wahr geworden, über das Staatenlenker noch immer streiten.
Was anderswo als Utopie gilt, gehört im Burgenland zum Alltag.
Ein gutes Beispiel dafür ist die südburgenländische Stadt Güssing – Güssing nimmt seit vielen Jahren eine vorbildliche Vorreiterrolle bei Erneuerbarer Energie ein und setzt schon seit den frühen 1990er Jahren auf nachhaltige Energiegewinnung. Das Burgenland soll zu einer der ersten klimaneutralen Regionen der Welt werden, Güssing geht seit Jahrzehnten diesen Weg konsequent mit. Im nächsten Schritt geplant ist die Nutzung des unerschöpflichen Potentials der Sonnenenergie in Form von Photovoltaik. Im Burgenland wird neben Windenergie künftig für die Erreichung der Klimawende verstärkt auf Photovoltaik gesetzt. Sonnenstrom ist leistbar, klimaneutral, emissionsfrei und komfortabel.
Güssing wird auch hier mit einem geplanten SonnenPark der Vorreiterrolle gerecht und forciert nachhaltigen, regionalen Sonnenstrom. Zahlreiche Studien belegen zudem, dass sich Photovoltaikanlagen in der Freifläche positiv auf Flora und Fauna auswirken. Spätestens hier wird klar, dass sich das jüngste Bundesland im zweiten Jahrhundert seines Bestehens zur Zukunftsregion gemausert hat. Ganz so, wie es der norddeutsche Besucher Hebbel formulierte: eine kleine Welt, in der die große ihre Probe hält..